Komplexitätsreduktion: Warum wir uns selbst im Weg stehen
- Nina Kindervater

- 6. Apr. 2025
- 2 Min. Lesezeit
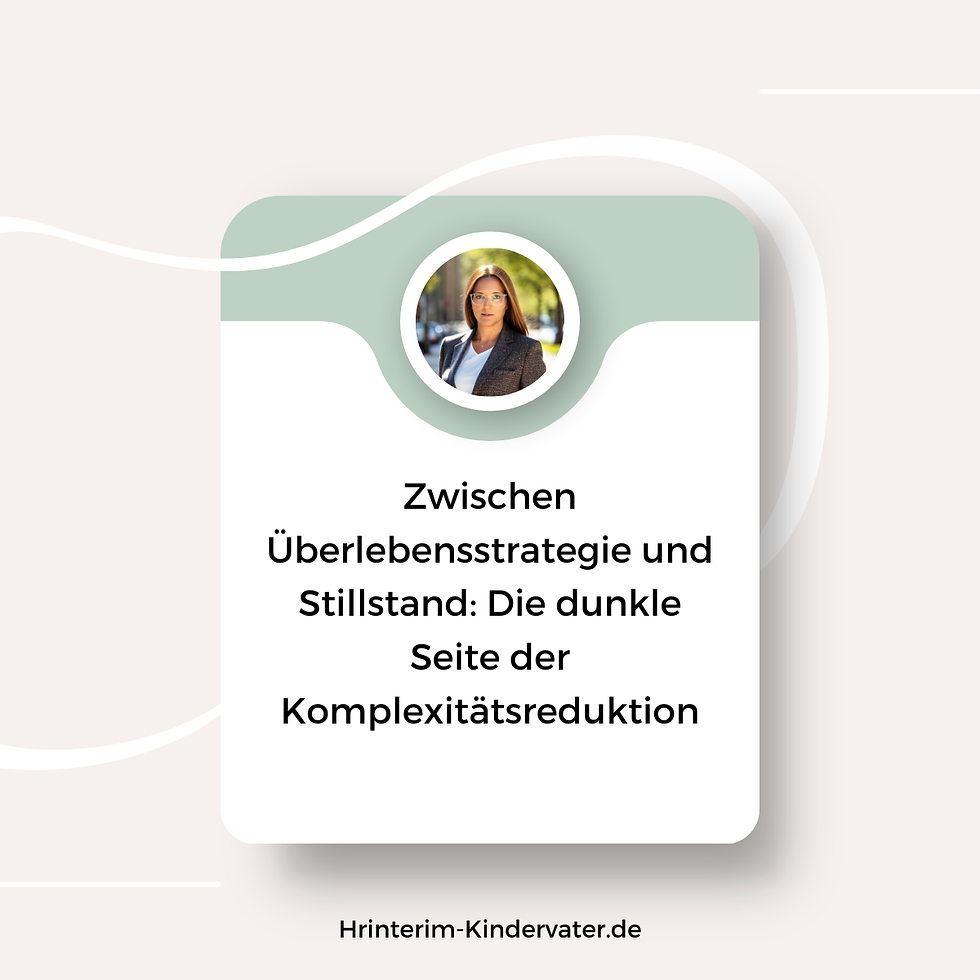
Warum unsere mentalen Abkürzungen mehr schaden als nützen – und was Coaching wirklich leisten muss
Wir leben in einer Welt, in der „Komplexität“ zur Alltagsdiagnose geworden ist: Alles wird schneller, unübersichtlicher, mehrdeutiger. Wer in Führung, HR oder Beratung unterwegs ist, kennt die Klage: „Die Leute wollen einfache Lösungen!“ Und tatsächlich – wir Menschen sind nicht nur Problemlöser:innen, sondern vor allem Komplexitätsreduzierer:innen.
Wir vereinfachen, um zu überleben. Doch genau hier beginnt das eigentliche Problem.
Der Sinn der Vereinfachung – und seine Nebenwirkungen
Psychologisch gesehen können wir komplexe soziale Systeme nur dann bewältigen, wenn wir sie kognitiv reduzieren. Wir bedienen uns sogenannter Sinnattraktoren – stabiler Interpretationsmuster, die unsere Wahrnehmung, Emotionen und unser Verhalten strukturieren. Sie helfen uns, nicht jede neue Situation vollkommen neu analysieren zu müssen. Ein Beispiel: Wer einmal gelernt hat, dass „mein Chef autoritär“ ist, muss nicht jedes Gespräch neu bewerten. Die Zuschreibung steht – und wirkt.
Doch diese Vereinfachung ist nicht neutral. Sie ist eine selektive Brille, durch die wir Wirklichkeit wahrnehmen – und zugleich eine Falle, wenn sie sich gegen uns selbst wendet. Was einmal Schutz geboten hat, kann in dynamischen Kontexten schnell zur Belastung werden.
Confirmation Bias als Systemverhinderer
Das Gehirn liebt Konsistenz. Widersprüchliche Informationen, die nicht zum vorhandenen Bild passen, werden ausgeblendet oder umgedeutet. Der Confirmation Bias lässt uns das sehen, was wir ohnehin schon glauben. Die Folgen sind gravierend: Wahrnehmung verengt sich, Handlungsspielräume schrumpfen – und Veränderung wird unmöglich.
Heinz von Foerster forderte einst: „Handle stets so, dass die Anzahl der Wahlmöglichkeiten größer wird.“ Genau das Gegenteil geschieht, wenn Menschen in überstabilen Sinnmustern verharren. Was als mentale Entlastung begann, wird zum psychologischen Käfig.
Coaching als Prozess der Re-Komplexifizierung
Im Coaching begegnen wir häufig Klient:innen, die an dysfunktionalen Deutungsmustern festhalten – häufig, weil diese Muster früher sinnvoll und funktional waren. Sie basieren auf emotionalen Überlebensstrategien, die unter neuen Bedingungen jedoch versagen. Eine Führungskraft, die Kontrolle als Schutz vor Chaos gelernt hat, erlebt Agilität als Bedrohung. Ein:e Mitarbeiter:in, der/die früh gelernt hat, „alles alleine zu machen“, wird im Team zur Blockade.
Coaching bedeutet dann nicht nur „Ziele erreichen“, sondern auch: die Möglichkeit zur Re-Organisation eigener Wahrnehmung und Interpretation schaffen. Es geht um das Verlernen, nicht das Lernen. Um das Erkennen, nicht das Erklären.
Fazit: Wer Wandel will, muss Mehrdeutigkeit aushalten können
In einer sich ständig verändernden Welt ist Stabilität kein Zustand, sondern eine Aufgabe – und Komplexitätsreduktion kein Ziel, sondern eine Zwischenlösung. Wer dauerhaft in alten Interpretationen verharrt, verhindert Entwicklung – bei sich selbst, in Teams und in Organisationen.
Die gute Nachricht: Komplexität lässt sich nicht abschaffen, aber unser Umgang mit ihr lässt sich gestalten. Genau hier beginnt die eigentliche Arbeit von Coaching und Führung.



Kommentare